Kältejahre – Missernten
"Aufgrund einer Klimaanomalie kommt es in Europa ab 177o mehrere Jahre hintereinander zu sehr kalten Wintern, teilweise kühlen Sommern mit verheerenden Niederschlägen und Überschwemmungen. "Das Jahr 1770 begann mit strenger Kälte und viel Schnee, dann setzte Tauwetter ein und verursachte Überschwemmungen." Auch an der Schwarzen Elster traten in den Jahren 1770 und 1771 Extremhochwässer auf. "Die Temperaturen bewegten sich zwischendurch im Februar und März in einem Bereich, dass gesät werden konnte. Gegen Ende des ersten Frühlingsmonats, am 19. März, brach eine fürchterliche Kälte ein, die in den folgenden Tagen großflächig das Wintergetreide vernichtete, darauf fielen Schneemassen", so Hartstock.
Die Stände beantragten für insgesamt 99 Orte im Budissiner Kreis, die einen Totalverlust von 10.365 Scheffel Aussaat und 12.534 Fuder Wiesenheu erlitten hatten und damit Missernten verursachten, Hilfen. Hungersnot war auch in Kamenz die Folge.
1771 entstand wegen großer Nässe Theuerung. Der Schfl. Korn stieg von 1. Rf. 8gl. auf 9 rf. und das Getraide war nicht einmal zu bekommen, beschreibt der Chronist Friedrich Gotthelf Richter.
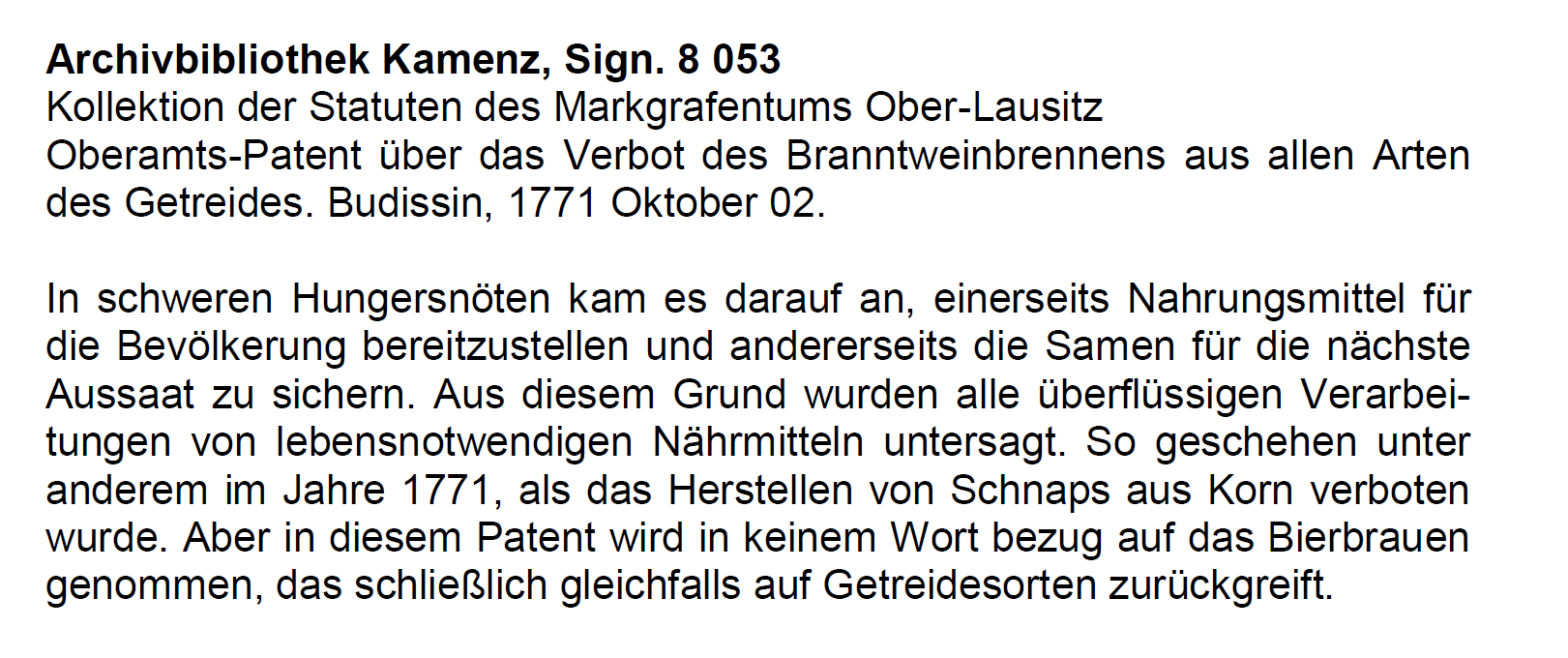
Hartstock beschreibt den Winter 1776:
"Der Winter des Jahres 1776 zählt zu den denkwürdigsten in der Oberlausitz. Spätere Chroniken vermerken sogar, dass die trockene Kälte am 28. Januar mit -32,5 Grad Celsius den Tiefpunkt des gesamten Jahrhunderts erreichte. ... Menschen kamen durch den Kältetod selbst in ihren Behausungen ums Leben, Tiere erfroren, Flüsse, Bäche, Teiche und Seen waren von unglaublich dicken Eispanzern bedeckt. Es fehlte überall an Wasser, auch die Mühlen standen still. Das Mehl zum Brot wurde knapp. Die Sorgen wollten nicht enden."


Quelle
Thomas Binder: Die echten Kamenzer Biere -Ausstellung des Stadtarchivs Kamenz. In: Korrespondenzblatt Neue Folge 6 Kamenz - November 2007, S. 6 - 19.
Erhard Hartstock: Die Geschichte der Plagen der Oberlausitz - Eine Chronik der Ereignisse von 1112 bis 1869, Oberlausitzer Verlag Spitzkunnersdorf 2017, S. 319 - 330.
Friedrich Gottlieb Richter: Chronik der Stadt Kamenz, 1797, Stadtarchiv Kamenz, Chroniken Nr. 3
Foto
Dirk Synatzschke

